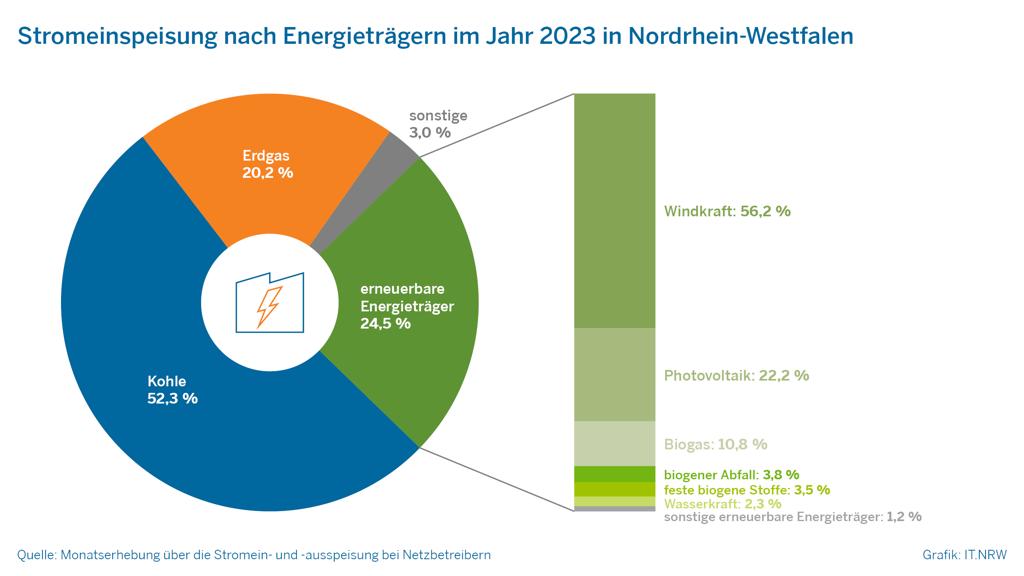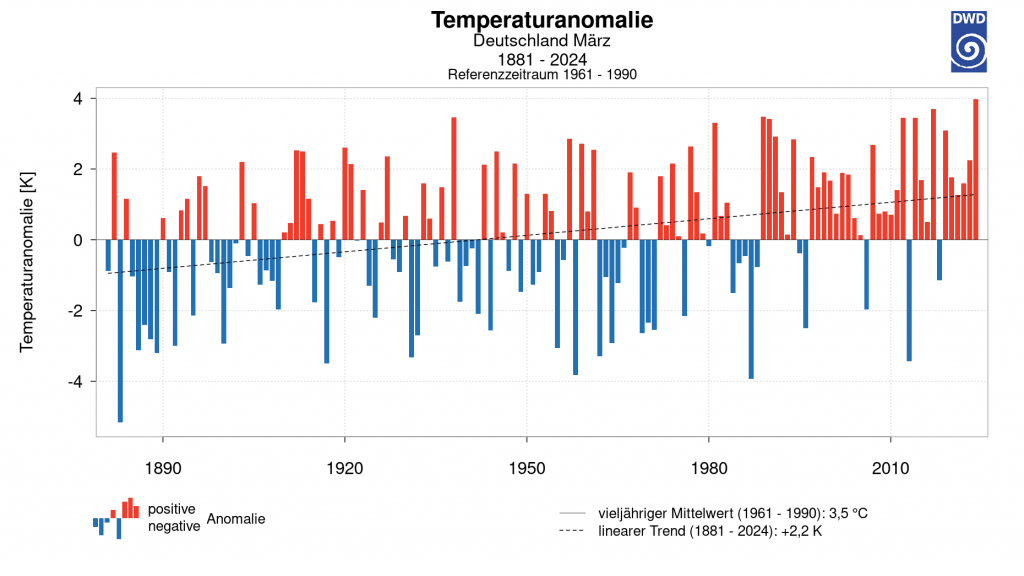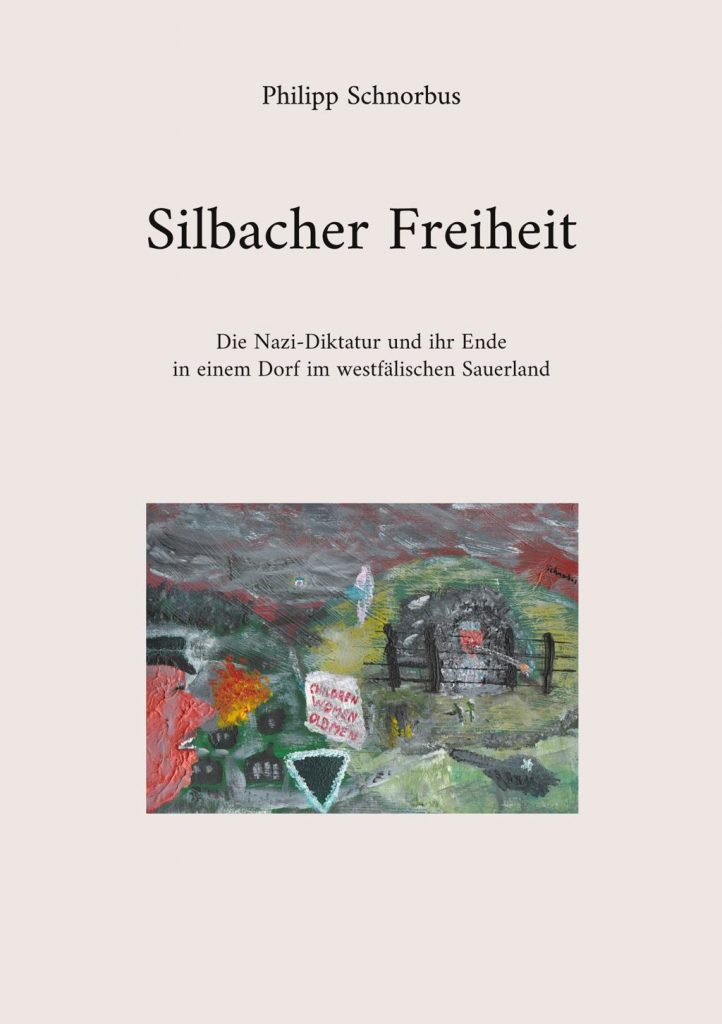Einladung zur Vernissage am Freitag, 3. Mai 2024 um 19 Uhr

Nach den Ausstellungen mit Otto Waalkes, Udo Lindenberg, Frank Zander und Francis Fulton-Smith ist dies die 5. Ausstellung in Zusammenarbeit mit den Walentowski Galerien aus Werl.
Der Förderverein Hallenberg freut sich, dass beide Künstler persönlich in den Kump kommen um die Ausstellung zu eröffnen: „Lernen Sie Alexandra Hofmann und Thomas Jankowski kennen und lassen Sie sich von der Vielfalt ihrer Kunst überraschen.“
„Modern Art – Alexandra Hofmann und Thomas Jankowski im Hallenberger Kump“ weiterlesen