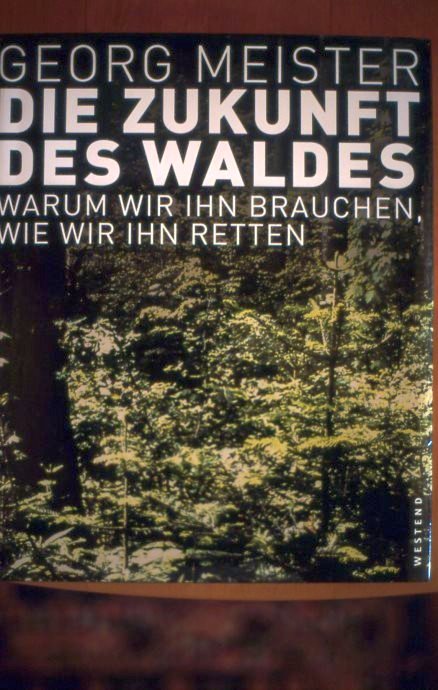Die Würfel sind gefallen: 2/3 Zustimmung der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag. Doch was viel höher zu bewerten ist: 1/3, nämlich ca. 120.000 Genossen, sprachen sich dagegen aus. Und über 100.000 Mitglieder nahmen – vermutlich aus Frust und Zorn – erst gar nicht an der Abstimmung teil.
Die Würfel sind gefallen: 2/3 Zustimmung der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag. Doch was viel höher zu bewerten ist: 1/3, nämlich ca. 120.000 Genossen, sprachen sich dagegen aus. Und über 100.000 Mitglieder nahmen – vermutlich aus Frust und Zorn – erst gar nicht an der Abstimmung teil.
Positiv zu bewerten ist die prompte Ankündigung der Jusos, daß der Widerstand gegen die Groko aufrechterhalten wird. Und die SPD-Spitze wird es sich kaum leisten können, daß sie denjenigen, die bei der Mitgliederbefragung mit NEIN gestimmt hatten, in Zukunft keine Beachtung mehr schenkt und sämtliche Kritik an sich abprallen läßt, getreu dem Motto: Wir sitzen fest im Regierungssattel; uns kann nichts mehr passieren. Aus gutem Grund initiierten die Jungsozialisten unmittelbar nach der Abstimmungsniederlage die Gründung eines Linksbündnisses mit dem Ziel, ein starkes Gegengewicht zu der kontinuierlich nach „rechts“ rückenden Parteienlandschaft anzustreben. Unzufriedenen Genossen und auch Grünen soll damit eine neue Heimat geboten werden.
Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine hatten vor geraumer Zeit ebenfalls die Gründung einer linken Sammlungsbewegung ins Spiel gebracht, um jenseits des „rechten Lagers“ eine neue Machtperspektive zu schaffen, von der man sich erhofft, daß sie eines Tages mehrheitsfähig wird. Doch es würde vermutlich noch sehr lange dauern, bis ein solches Projekt eventuell von Erfolg gekrönt ist.
Das Regierungsmodell SPD, Grüne, Linkspartei hat für einen überschaubaren Zeitraum sowieso keine Chance auf Regierungsübernahme; es wurde von Seiten der Linken bereits „für tot“ erklärt. Und betrachtet man die ins Ministeramt berufenen SPD-Politiker, so ist zu befürchten, daß sie entgegen ihrer Ankündigung, dem Koalitionspartner CDU/CSU das Leben, sprich das Regieren schwerer zu machen, doch wieder in den alten Trott verfallen und jeden Kritiker, der es wagt aufzumucken, daran erinnern werden, daß schließlich 66 Prozent der Basis für eine Fortsetzung von Schwarz-Rot votiert haben.
Es scheint so, als wäre diese Partei mit ihrem überwiegend aufgebrauchten Personal einfach unfähig, aus Fehlern zu lernen. Deshalb kann man von diesen Leuten auch gar nicht erwarten, daß sie große Reformen auf den Weg bringen.
Es geht ein tiefer Riss durch die ehemalige linke Volkspartei SPD. Geschwächt und gespalten, also unter sehr ungünstigen Voraussetzungen, flüchtet sie sich erneut in eine Große Koalition – und gibt sich damit selber auf. Sie hat kein Ehrgefühl. Ihr fehlt es nach wie vor an dem nötigen Selbstbewußtsein. Sie ist von sich selbst nicht überzeugt. Sie hat das getan, was die Union von ihr erwartet, nämlich für eine Neuauflage der Groko einzutreten, nur damit Frau Merkel im Amt bleiben kann – und nennt dies „Staatspolitische Verantwortung“. In Wirklichkeit verhält es sich doch so, daß kein SPD-Mandatsträger oder Minister (ehemaliger oder zukünftiger) seinen Posten verlieren bzw. auf sein Amt verzichten will. Und die Partei liegt derzeit in Umfragen doch nicht deshalb bei nur 18 – 19 Prozent, weil Gegner der Koalitionsvereinbarung den Marsch in die Opposition empfohlen hatten.
Das Attribut „Anwalt der kleinen Leute“ ist bei der SPD längst zur Makulatur geworden. Wo bleibt die alte Forderung der Genossen nach Wiedereinführung der Vermögensteuer oder einer Sonderabgabe für Reiche, wie es die Linkspartei postuliert? Wie will die Partei angesichts des rapide schwindenden Rückhalts in der Bevölkerung ihre Kernforderungen durchsetzen; wie will sie sich profilieren? Andrea Nahles als Vertreterin der „alten Garde“ und vermutlich zukünftige SPD- Vorsitzende wird vom Rednerpult auf Kanzlerin Merkel und deren CDU und CSU schimpfen nach allen Regeln der Kunst, während ihr Parteifreund, Finanzminister Scholz, gleichzeitig die hervorragende Zusammenarbeit mit Frau Merkel anpreist.
Bei Scholz rechne ich damit, daß er durch seinen Minister Heiko Maas noch mehr Geld ins Ausland transferiert und bereitwillig großzügige finanzielle Geschenke verteilt – an EU-Staaten oder solche, die noch auf der Warteliste stehen, die aber für den Zusammenhalt und die politische Stabilität der Gemeinschaft ohne jeden praktischen Nutzen sind. Und das würde passieren, obwohl die Ausgaben der EU durch den Wegfall Großbritanniens (Brexit) eher gesunken sind, auch wenn man berücksichtigt, daß Großbritannien einer der größten Nettozahler innerhalb der EU war.
Es ist bestimmt kein Zufall, daß der französische Staatspräsident Macron und EU-Kommissar Juncker sich bereits bei den laufenden „Jamaika“-Sondierungsgesprächen“ eingemischt hatten und nachdrücklich auf die Bildung einer Großen Koalition drängten, da sie genau wußten: Man kann sich auf die Zahlungsfreudigkeit der Sozialdemokraten, aber auch auf die der Unionisten verlassen. Eine solche, allzu freizügige Ausgabenpolitik, wäre mit Regierungsbeteiligung der Europa kritischen FDP und besonders der stärksten Oppositionspartei AfD nie möglich. So aber wird man davon ausgehen können, daß sich der Bundesfinanzminister für eine Vergemeinschaftung der Schulden innerhalb der EU ausspricht, wobei allerdings sehr zu bezweifeln ist, ob es auch hier ein „Weiter so“ geben kann.
Der schwarz-rote Koalitionsvertrag erweist sich bei genauer Lektüre als riesige Geldverteilungsmaschine. Frau Merkel und ihre Minister glauben immer noch mit Geld ließe sich alles regeln, man könne sämtliche Bevölkerungsschichten zufriedenstellen, wenn nur alle vom Kuchen ein großes Stück serviert bekommen. Die Koalitionäre haben jedoch noch immer nicht erkannt, daß für die Leute mittlerweile Geld nicht mehr alles ist und die vielzitierten Werte wieder stärker in den Vordergrund rücken.
In ihrer Regierungserklärung vom 21.3. 18 war die CDU-Chefin eifrig darum bemüht, den politischen Stillstand und die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte unter ihrer Kanzlerschaft auszublenden und mit wortgewaltiger Rhetorik vergessen zu machen. Was der interessierte Zuschauer aus ihrem Munde hörte, war ein Füllhorn von Versprechungen. Das ist nicht nur zutiefst unseriös, sondern beweist auch, daß in den 12 Jahren Merkel kein Projekt in die Tat umgesetzt bzw. erfolgreich zum Abschluß gebracht wurde.
Und auch für die nächsten 3 ½ Jahre kann davon ausgegangen werden, daß die alte und neue Kanzlerin ihren gewohnten Regierungsstil beibehält: Unangenehmes aussitzen, in Ruhe abwarten, aus sicherer Distanz die Geschehnisse beobachten und nur dann sich öffentlichkeitswirksam zu Wort melden, wenn es gerade opportun erscheint und man sein eigenes Image aufpolieren kann. Nur wird auch Merkel begreifen müssen, daß die Politik der „ruhigen Hand“ der Vergangenheit angehört.
Das Regieren dürfte viel schwieriger werden, schon allein deshalb, weil sich schon bei der Kanzlerwahl am 14. März im Deutschen Bundestag gezeigt hat, daß eine unerwartet große Zahl von Abgeordneten aus den Reihen von Union und SPD, nämlich 35 von 399 Stimmberechtigten der Koalition Merkel die Gefolgschaft verweigerten. Auch das ist eine schwere Bürde und somit schlechtes Signal für den Start der Merkel-Administration. Vielleicht haben einige gestandene Sozialdemokraten auch noch nicht vergessen, was die die CDU-Chefin kurz vor der BTW lauthals ertönen ließ, daß nämlich die SPD „auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig sei.“
Den Befürwortern einer Groko wird es noch sehr leidtun, daß sie sich von der Führungsriege der SPD haben überrumpeln lassen. Viele Mitglieder haben meiner Ansicht nach deshalb mit Ja gestimmt, weil von der Parteispitze gezielt Ängste vor Neuwahlen geschürt wurden, die im Fall der Ablehnung der Koalitionsvereinbarung fällig geworden wären. Wenn man jedoch Neuwahlen von vornherein so kategorisch ausschließt und auch eine Minderheitsregierung angeblich keine Option sein darf, dann leben wir doch im falschen System. In einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie müssen sowohl das eine wie auch das andere immer möglich sein.
Eine Minderheitsregierung ist ein Modell, das auf wechselnden Mehrheiten basiert. Aber diese Möglichkeit wurde von der Kanzlerin nie in Betracht gezogen, wohlweislich nicht, weil sie dann gezwungen wäre sich auch mal abzurackern. Sie wäre, was ein Novum darstellt, zum ersten Mal richtig gefordert. Die Arbeit ginge ihr nicht mehr so leicht von der Hand. Sie müßte sich also ihre Mehrheiten suchen, um diverse Gesetzesvorhaben über die parlamentarische Hürde zu bringen. Da ist es für eine Kanzlerin mit Showtalent doch weitaus bequemer, zusammen mit einer unterwürfigen und wankelmütigen SPD zu regieren.
Letztere muß sich zu Recht vorwerfen lassen zu keinem Zeitpunkt ein Bündnis mit Linkspartei und Grünen auch nur in Erwägung gezogen zu haben. Stattdessen wählt man den einfachsten Weg und macht sich erneut zum Steigbügelhalter einer unionsgeführten Regierungschefin. Zu allem Überfluß überläßt man der AfD auch noch die Oppositionsführerschaft im Bundestag. Der unwiderstehliche Drang, Ämter anzupeilen oder bereits besetzte Posten zu behalten, wiegt in jedem Fall stärker als der zwar lange und beschwerliche, aber letztendlich erfolgversprechendere Kurs eines Wiedererstarkens der SPD in der Opposition. Ein Absturz in die Bedeutungslosigkeit bliebe ihr vermutlich dadurch erspart.
Die Partei von Brandt, Wehner und Eppler hat unter ihrer neuen Vertretung einen großen Teil an Wählern und Mitgliedern verloren; und sie hat gegenüber früheren Jahrzehnten ihren Stimmenanteil mehr als halbiert. Eine Vielzahl von Neueintritten binnen relativ kurzer Zeit hat nicht dazu geführt, daß die SPD davon in den Umfragen profitiert hätte.
Mir ist schleierhaft, wie der vielbeschworene Erneuerungsprozeß innerhalb der Sozialdemokratischen Partei vonstatten gehen soll – unter der Knute einer Kanzlerin, die nach meiner Einschätzung sämtliche Erfolge oder besser gesagt Scheinerfolge der Regierungsarbeit für sich und ihre CDU reklamieren wird. Eine programmatische Erneuerung, die zugleich mit einem völlig verjüngten Personal einhergehen muß, kann – wie gesagt – nur in der Opposition gelingen.
Betrachtet man sich jedoch die dem neuen Kabinett angehörenden Minister der SPD, so handelt es sich ganz überwiegend um Vertreter der alten Garde, von denen m. E. nach niemand für einen wirklichen Neuanfang steht. Zweifel an der fachlichen Kompetenz sind mehr als berechtigt. K. Barley, promovierte Rechtswissenschaftlerin, zuständig für Justiz und Verbraucherschutz, bildet da schon eine Ausnahme. Fragt sich nur, ob sie sich gegen einen Innenminister Seehofer wird durchsetzen können.
Die allermeisten Personalentscheidungen sind Fehlbesetzungen. Abgesehen von ein paar neuen Köpfen (Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin, Jens Spahn oder Julia Klöckner) bleibt alles beim Alten. Die Kanzlerin hat ihr treu ergebene Weggefährten in wichtige Ämter berufen und mit Spahn einen – wie ich glaube – vermeintlichen Merkel- Kritiker in die Parteidisziplin eingebunden. Dieser hatte sich aber schon vor Amtsübernahme durch seine unseligen Äußerungen über „Hartz IV“ als Minister disqualifiziert. Hier zeigt sich wieder, daß es nicht in erster Linie darauf ankommt, ob jemand für einen Ministerposten geeignet ist, sondern wer die besten Beziehungen hat. Die Postenvergabe ist zumal bei Frau Merkel rein taktischer Natur.
Von einem Ressort ins andere springen, – wie es heute üblich ist -, das können nämlich nur Ungelernte. Was bislang so über die neuen Köpfe durchgedrungen ist, läßt nichts Gutes ahnen: Julia Klöckner stammt zwar aus einer Winzerfamilie und war bereits einmal Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, hat sich aber ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert, nimmt man eine ihrer Aussagen als Beispiel. „ Man muß Ökobauern in schlechten Phasen den Einsatz konventioneller Pflanzenschutzmittel erlauben können“. Wer so etwas sagt, erfüllt eben nicht die Voraussetzungen für ein Regierungsamt in Berlin oder anderswo und ist schon durchgefallen, bevor es losgeht. Julia Klöckner als Ressortchefin des Agrarministeriums ist somit eine totale Fehlbesetzung.
Das betrifft auch den Bereich Natur und Umwelt, das erneut an die Sozialdemokraten gegangen ist. Zwar liest man gerne, daß die neue Ressortchefin Mitglied bei Nabu und Slowfood ist; gleichzeitig gehört sie aber auch der Gewerkschaft IG Bergbau und Energie an, einer Gewerkschaft also, die natürlich eine große Nähe zur Kohlelobby aufweist. Letztere wird möglicherweise nichts unversucht lassen Einfluß auf das SPD-geführte Umweltressort zu nehmen. Da müßte man die Wirtschaftslobby doch schlecht kennen. Noch jeder frisch gebackene Umweltminister hat zu Beginn seiner Amtszeit betont, daß Ökologie und Ökonomie miteinander versöhnt werden müßten. Was das aber in Wirklichkeit bedeutet, kann sich jeder eingefleischte Öko-Aktivist an fünf Fingern abzählen: Den Interessen der Industrie sollen noch etliche Hintertürchen offen gehalten werden.
Und noch eine schlechte Nachricht: Das Umweltministerium wurde im Rahmen der Koalitionsverhandlungen deutlich verkleinert, obwohl die Aufgaben in diesem Bereich ständig größer werden. Enorm wichtige und zukunftsträchtige, von starken Lobbyverbänden dominierte Ressorts, wie z. B. Verkehr, Energie, Land- oder Bauwirtschaft fallen paradoxerweise nicht in die Kompetenz des Umweltministeriums. Das verwundert umso mehr als diese Ressorts ein erhebliches ökologisches Konfliktpotenzial aufweisen, sprich einen bekanntermaßen höchst negativen Einfluß auf die noch vorhandenen Naturschätze unseres Landes haben. Unvereinbare Gegensätze prallen also aufeinander: Auf der einen Seite der nutzungsorientierte Wirtschaftslobbyismus und deren wachstumsgetriebener Expansionsdrang, von dem auf der anderen Seite äußerst sensible Bereiche wie Natur- und Biodiversitätsschutz überrollt zu werden drohen.
Die Vergabe des Finanz-, Umwelt-, Justiz-, Arbeits-, Außen- und Familienministeriums an die SPD kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Koalitionspartner CDU und CSU wichtige Schlüsselressorts bekam. Die Union – machen wir uns nichts vor – sitzt am längeren Hebel. Deren Fachressorts kommt insofern entscheidende Bedeutung zu als hier die Weichen für die Zukunft gestellt werden.
In Gestalt von Horst Seehofer haben die Sozialdemokraten zudem einen Politiker vor sich, der in der Asyl-, Migrations- und Flüchtlingsfrage eine ganz andere Auffassung vertritt und somit auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner geht. Nehmen wir einmal an, die CDU/CSU startete im Bundestag gegen den ausdrücklichen Willen der SPD eine Gesetzesinitiative zu diesem Thema und holte sich dafür, um das Gesetz über die parlamentarische Hürde zu bringen, die Unterstützung der AfD. Oder was wäre, wenn im umgekehrten Fall die AfD einen Antrag einbrächte, der mit Unterstützung der Unionsparteien in Gesetzesform gegossen würde. Damit wäre eine ernste Situation entstanden, die von den Sozialdemokraten eigentlich nicht hingenommen werden könnte.
CDU/CSU und SPD, obgleich am 24.9. vom Wähler abgestraft und faktisch ohne Regierungsauftrag, eint der ungebrochene Wille zur Macht. Nicht weil man partout miteinander regieren möchte. Aber die SPD hat nur die Wahl zwischen Pest und Cholera: Auch wenn es ihr nochmals gelungen ist sich in eine Groko zu retten, kann sie ihrem Schicksal nicht entrinnen. Die Quittung wird ohnehin erteilt, spätestens bei den im kommenden Jahr in Ostdeutschland stattfindenden Landtagswahlen. Aber auch schon dieses Jahr dürfte es für die Genossen in Bayern und Hessen ein Desaster geben. Was nützen 50.000 Neueintritte, wenn der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet? Der Mitgliederzuwachs kann sich auch rasch wieder ins Gegenteil verkehren.
Fakt ist, daß dieser unter Zeitdruck zusammengeschusterte Koalitionsvertrag nach eingehender Prüfung von parteiinternen Kritikern keine ausreichende Grundlage für 4 Jahre gemeinsamen Regierems bietet. Weil die Zeit drängte, und die Koalitionsverhandlungen möglichst schnell zum Abschluss gebracht werden sollten, wurden Streitigkeiten erst mal ausgeklammert. Die sind damit allerdings nicht vom Tisch, sondern werden offen ausbrechen, wenn man erst einmal gemeinsam regiert. Und siehe da: Schon fühlt man sich bestätigt: Die von Seehofer angestoßene Islam-Debatte sorgte bereits für erhebliche Unruhe. Diese Koalition steht – wie keine andere zuvor – unter hohem Erwartungsdruck. Die Wähler verlangen Antworten, wollen Taten sehen. Den Menschen muß endlich das Gefühl gegeben werden, daß man ernsthaft gewillt ist sich ihrer Interessen anzunehmen. Aber danach sieht es bisher nicht aus. Im Gegenteil: Jüngsten Äußerungen von Vertretern verschiedener Ministerien zufolge wird es ein Weiter so der bisherigen, an mächtigen Lobby-Verbänden orientierten Politik geben.
Der Inhalt der Koalitionsvereinbarung ist bei sorgfältiger Lektüre ein Sammelsurium von vage formulierten Absichtserklärungen; er ist schwammig, ziemlich unkonkret und läßt viele Fragen offen. Es fehlen auch diesmal ein Gesamtkonzept für die Bewältigung all jener großen Herausforderungen und ein zeitlicher Rahmen, innerhalb dessen die vielen anspruchsvollen Aufgaben erledigt werden müssen. Erneut werden wichtige Entscheidungen in eine unbestimmte Zukunft verlagert. Die aus Sicht der SPD wesentlichen Unterschiede zur Union könnten nur in einer ganz anderen Regierungskonstellation zur Geltung kommen und herausgearbeitet werden. In einem Zweckbündnis mit 2 völlig ungleichen Partnern ist man jedoch in seinen Entfaltungsmöglichkeiten von vornherein sehr eingegrenzt.
Es besteht ein nur sehr enger Handlungsspielraum für die Durchsetzung der eigenen Positionen, welche man – so befürchte ich – notfalls lieber kampflos aufgibt als einen Dauerstreit zu riskieren, der aber ohnehin vorprogrammiert ist und die Regierungsarbeit überlagern wird. Man ist dazu gezwungen, an den eigenen Inhalten, den Alleinstellungsmerkmalen, die jede Parteiprogrammatik auszeichnet und die nicht zur Disposition stehen sollte, zu viele Abstriche zu machen. Wie soll die SPD ihre Eigenständigkeit herauskehren, wenn sie auf Gedeih und Verderb in die Koalitionsräson eingebunden ist? Über einen Minimalkonsens wird man wahrscheinlich nicht hinauskommen. Es wird ein Kuhhandel des Gebens und Nehmens.
Der ökologisch-sozialen Herausforderung wird im Koalitionsvertrag erneut längst nicht jene Bedeutung zugemessen, die ihr gebührt. Bisherige Fortschritte bei wichtigen Zukunftsthemen sind allein dem öffentlichen Druck und dem unermüdlichen Einsatz von Naturschutzverbänden, Bürgerinitiativen und sonstigen außerparlamentarisch aktiven Organisationen zu verdanken, keinesfalls der Merkel-Regierung. Die Anhänger der Groko werden früher oder später einsehen, daß sie bei der Abstimmung im März falsch entschieden haben, wenn sich erst einmal herausstellt, daß ihre Amtsträger wenig bis nichts erreichen konnten – entgegen den vollmundigen Versprechungen.
Das Profil der Sozialdemokraten wird nach Ablauf der Legislaturperiode einem völlig abgenutzten Autoreifen entsprechen, welcher dringend der Auswechslung bedarf. Die Sozis scheinen immer noch nicht begriffen zu haben, daß es einer machtbewußten Kanzlerin Merkel und der CDU allein darum ging, den wankelmütigen Juniorpartner für ihre Interessen einzuspannen, nützlich allein als Mehrheitsbeschaffer.
Nun rühmen sich die Genossen damit, daß viele Forderungen der Partei im neuen Koalitionsvertrag verankert sind. Wollen wir doch mal einige Punkte herausgreifen und diese kritisch beleuchten.
Da wäre eine Erhöhung des Kindergeldes, wie es übrigens vor jeder Wahl versprochen wurde. Dieses erreicht aber nicht die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Es wird nämlich bei Hartz IV-Beziehern auf den Regelsatz angerechnet. D. h. daß derjenige Betrag, um den das Kindergeld steigt, von Hartz IV wieder abgezogen wird. Fazit: Der Effekt ist gleich Null. Außerdem gibt es nach wie vor etliche Arbeitnehmer, die mit Hartz IV aufstocken müssen, um ihren Lebensunterhalt überhaupt bestreiten zu können. Nach derzeitigem Stand existieren in Deutschland 18 Mio.(!) Hartz IV-Bezieher, eine erschreckend hohe Zahl.
Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen zur Tafel zu gehen, um genug zu essen zu haben, was sonst eben nicht der Fall wäre. Es gibt aber immer noch Politiker, die eben genau dies bestreiten. Allein in Hamburg leben derzeit ca. 15.000 Menschen von der Tafel. In ganz Deutschland gibt es nach derzeitigem Stand mehr als 800.000 Obdachlose. Kein Bundespolitiker hat bis heute gefordert, daß auch für diese Menschen Wohnungen gebaut oder bereitgestellt werden müssen.
Andererseits haben wir es mit Menschen zu tun, die zwar in Arbeit sind, sich aber keine Wohnung leisten können (Stichwort: bezahlbare Wohnungen). Die von der Groko 2013 auf Initiative der SPD beschlossene Mietpreisbremse erwies sich als Schlag ins Wasser.
Zweiter Punkt: Die Absenkung des Solidaritätszuschlags. Der nutzt aber sozial schwachen Bürgern auch nichts. Vielmehr kommen nur solche Menschen in den Genuß dieser Maßnahme, die auch Steuern zahlen. Und das sind wieder nur besser Betuchte.
Dritter Punkt: Der paritätisch (also von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) zu entrichtende Anteil zur Krankenversicherung hatte die SPD seinerzeit zugunsten der AG aufgekündigt; den Arbeitgeber also von dieser lange Gültigkeit besitzenden Regelung befreit. Nun wollen die Sozialdemokraten diese Gerechtigkeitslücke wieder schließen. Ob sie das mit ihrem Koalitionspartner durchsetzen können, ist aber keineswegs sicher. Die SPD-Führungsriege preist das m. E. zu Unrecht als großen Erfolg. Ein sozialdemokratisches „Leuchtturmprojekt“ ist es wahrlich nicht.
Vierter Punkt: Im Bereich Pflege sollen lt. Übereinkunft zwischen den Partnern 8.000 Pflegekräfte zusätzlich bereitgestellt werden. In Deutschland gibt es etwas mehr als 13.000 Seniorenheime. Somit entfiele auf jede Unterkunft nicht mal eine Pflegekraft. Es ist auch keine Rede davon, wie der bestehende Pflegenotstand durch eine deutliche bessere Bezahlung und Qualifikation überwunden werden soll. Damit so wenig Menschen wie möglich vorzeitig im Pflegeheim landen, müßte zuallererst dafür gesorgt werden, daß sich die Leute lange selbst helfen können.
Fünfter Punkt: Lt. ARD-Magazin PANORAMA will die neue Bundesregierung bei Zeitungszustellern die Rentenbeiträge für Arbeitgeber kürzen (von 15 % auf 5 %), und zwar nachweislich nicht nur mit Zustimmung der CDU/CSU, sondern auch jener der Sozialdemokraten, die das natürlich zunächst bestritten haben. Kritiker befürchten dadurch eine Aushöhlung des Mindestlohns. Weniger Rente für Niedriglöhne: Das muß man sich mal vorstellen! Momentan bekommen Zeitungszusteller, die als Minijobber unter schlechten Arbeitsbedingungen mitten in der Nacht bei Wind und Wetter stundenlang unterwegs sind, 8,84 € Mindestlohn pro Stunde. Das ist menschenunwürdig und eine Schande für eine Kulturnation.
Und wie sieht es mit der Generationengerechtigkeit in Deutschland aus? Das Rentenpaket ist nicht generationengerecht. Es enthält keinen Mut zur Zukunft. Die beitragsbezogene Rente hat m. E. ausgedient. An ihr festzuhalten, wäre daher ein Riesen-Fehler. Sie müßte nämlich von der jungen Generation aufgebracht werden. Notwendig wäre deshalb eine aus Steuermitteln finanzierte Alterssicherung. Rente und Gesundheit sind schließlich ein Gemeinschaftsprojekt für alle Generationen.
Aber dafür schafft man aus Willfährigkeit gegenüber der Airline- und Flugverkehrslobby die Luftverkehrssteuer ab, obwohl sie niemandem wehtut. Sie hätte eine ökologische Lenkungswirkung, da sie als zusätzliche Steuer auf Tickets erhoben wird. Folgerichtig müssten ja auch lt. Bündnis 90/Die Grünen endlich die großen Dienstwagen erheblich teurer werden. Eine auch schon uralte Forderung. Doch an dieses heiße Eisen traut man sich bis heute nicht heran. Dafür sind die selbst ernannten „Volksvertreter“, die schwören, „Schaden vom deutschen Volk abzuwenden“, zu sehr von Lobbyisten abhängig. Es fehlt der Mut, es fehlt die Courage.
Das Rentenkonzept ist unausgegoren bzw. absolut ungeeignet, die Probleme in den Griff zu bekommen, da nicht gegenfinanziert. Ein seriöses Finanzkonzept fehlt. Mütter werden gegen ihre eigenen Kinder ausgespielt.
Noch ein unrühmliches Beispiel ist die so genannte Bodenwertsteuer. Damit sollen Spekulanten stärker belastet werden (Siehe ARD-Sendung Monitor vom 22.2. 18); doch die Politik mauert, so Georg Restle, Leiter der Redaktion. „Wie schafft man Gerechtigkeit in einem Land, in dem die 45 reichsten Haushalte so viel besitzen wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung? Auch darüber hätte man gerne etwas im Koalitionsvertrag gelesen. Z. B. wenn es um Eigentum an Grund und Boden geht. Dazu finden sich allerdings nur vage Absichtserklärungen, so MONITOR.
Es wird meiner Einschätzung nach auch in den nächsten 3 ½ Jahren (falls die Koalition – wie gesagt – überhaupt so lange besteht), nur wieder Kompromisse auf kleinstem gemeinsamen Nenner geben. In der Sache rechne ich auf keinem politischen Terrain mit substanziellen Fortschritten, die dieses Land ein großes Stück nach vorne bringen würden. Von Politikerseite ist aber nur immer nur zu hören, was in diesem Lande nicht geht.
Stattdessen wird sich – so ist zu befürchten – die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vertiefen, weil niemand ein Interesse daran hat, an den Ursachen der Systemkrise Grundsätzliches zu ändern.
Daß dieser Koalitionsvertrag in großen Teilen wieder die Handschrift der Lobbyisten trägt, dafür ist auch die Umwelt- und Klimapolitik ein Paradefall. Was Union und SPD ausgehandelt haben, ist ein einziges Desaster. Es grenzt schon an Wahnsinn, daß die bereits erwähnte Luftverkehrssteuer gestrichen wurde. Hieraus folgt eine weitere Schwächung der Konkurrenzfähigkeit der Bahn als umweltfreundlichstes Massentransportmittel. Und das Klimaabkommen von Paris, ein völkerrechtlicher Vertrag mit dem Ziel, bis 2020 die CO²-Emissionen deutlich herunterzufahren, wird faktisch außer Kraft gesetzt. Der Kohleausstieg wurde dank dem neuen Wirtschaftsminister Altmaier und NRW-Ministerpräsident Laschet erneut auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Und der extrem umwelt- und klimaschädliche Luftverkehr wird weiterhin in Milliardenhöhe subventioniert. Das betrifft sowohl Flughäfen als auch Flugbetrieb. Letzterer ist paradoxerweise von der Kerosinsteuer befreit, bei internationalen Flügen auch von der Mehrwertsteuer. Diese Maßnahmen treffen natürlich all jene, die in sozialer Hinsicht am schlechtesten dran sind. Denn die finanziellen Mittel, die jetzt nicht bereitgestellt werden, fehlen z. B. zur wirksamen Bekämpfung der Kinderarmut. Auch in diesem Punkt lautet also die Devise: Mit Volldampf in den Untergang!
Mein Fazit ist: Angela Merkel wird dieses Land in 4 Jahren mit Karacho an die Wand gefahren haben. Wir sind auch nach 12 Jahren Schwarz-roter und Schwarz-gelber Führung Lichtjahre davon entfernt ein Land zu sein, „in dem wir gut und gerne leben“ (Merkel), sondern eines, das in keinem Bereich für die Zukunft gerüstet ist. Dazu zählt übrigens auch der in jeder Hinsicht miserable Zustand der Bundeswehr, den eine Ursula von der Leyen zu verantworten hat, auch wenn man berücksichtigen muß, daß ihre Amtsvorgänger an diesem erbärmlichen Zustand einen nicht unbeträchtlichen Anteil haben.
Karl Josef Knoppik, 03. April 2018


 Das unwürdige Gefeilsche bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen läßt folgenden Schluß zu: Frau Merkel will unbedingt weiter regieren. Mit wem und mit welchen Inhalten, spielt keine Rolle! Wegen der Unvereinbarkeit der sehr gegensätzlichen Standpunkte fehlte einer möglichen „Jamaika“-Koalition von vornherein ein tragfähiges Fundament.
Das unwürdige Gefeilsche bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen läßt folgenden Schluß zu: Frau Merkel will unbedingt weiter regieren. Mit wem und mit welchen Inhalten, spielt keine Rolle! Wegen der Unvereinbarkeit der sehr gegensätzlichen Standpunkte fehlte einer möglichen „Jamaika“-Koalition von vornherein ein tragfähiges Fundament.






























 Angela Merkel befindet sich permanent im Umfragehoch. Und das schon seit Jahren. Mal werden ihr bessere, mal etwas schlechtere Noten vergeben. Aber sie kann sich stets beruhigt zurücklehnen, war sie doch ihrem Hauptkonkurrenten, dem früheren SPD-Chef Gabriel, um Lichtjahre voraus.
Angela Merkel befindet sich permanent im Umfragehoch. Und das schon seit Jahren. Mal werden ihr bessere, mal etwas schlechtere Noten vergeben. Aber sie kann sich stets beruhigt zurücklehnen, war sie doch ihrem Hauptkonkurrenten, dem früheren SPD-Chef Gabriel, um Lichtjahre voraus. Ob es die Flüchtlings- und Asylfrage, die Außen- und Europapolitik oder verschiedene Bereiche der Innenpolitik betrifft, wo ein totaler Kurswechsel seit langem überfällig ist, etwa Landwirtschaft, Energie, Verkehr, Umwelt und Soziales: Die Kanzlerin und ihre schwarz-rote Regierung versagen auf ganzer Linie.
Ob es die Flüchtlings- und Asylfrage, die Außen- und Europapolitik oder verschiedene Bereiche der Innenpolitik betrifft, wo ein totaler Kurswechsel seit langem überfällig ist, etwa Landwirtschaft, Energie, Verkehr, Umwelt und Soziales: Die Kanzlerin und ihre schwarz-rote Regierung versagen auf ganzer Linie.