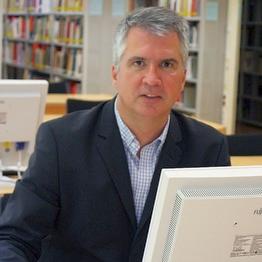
Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Dienstag, 26. Oktober, 18 Uhr, im Blauen Haus: Im März 1945 – kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges – verübten Angehörige von Waffen-SS und Wehrmacht zwischen Warstein und Meschede im Sauerland eines der größten Verbrechen in der Endphase des Krieges in Deutschland – außerhalb von Konzentrationslagern und Gefängnissen.
Exekutions-Kommandos ermordeten an drei Stellen im Arnsberger Wald insgesamt 208 polnische und russische Zwangsarbeiter. Auf der Grundlage langjähriger Forschungen von Historikern des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben LWL-Archäologen 2018 und Anfang 2019 Ausgrabungen an allen drei Tatorten durchgeführt.
Die Funde zeugen nicht nur von den letzten Stunden im Leben der Ermordeten, sondern geben auch Aufschlüsse über den Ablauf der grausamen Taten.
Der Historiker Dr. Marcus Weidner erläutert in seinem Vortrag die Hintergründe dieses Kriegsendphaseverbrechens, informiert über die Aufdeckung der Tat und die Verfolgung der Täter sowie die Erinnerung an das Verbrechen und die archäologischen Grabungen.
Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Besucher müssen einen Nachweis über eine Impfung, einen negativen Coronatest oder einen Nachweis über die Genesung vorzeigen. Anmeldungen und weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten zu den Öffnungszeiten des Museums telefonisch: 02931/94-4444 oder per Mail unter sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de.
