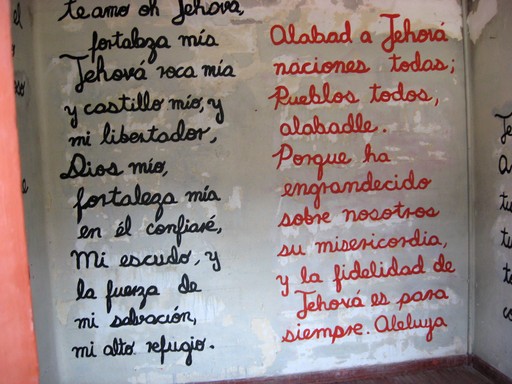Dieser Artikel ist der 17. Teil einer persönlichen Serie über das Leben in Mexico und Mexico-City. Heute verlässt die Autorin ihr Stammland und reist n die USA. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Hola a todos!
Wo befindet man sich, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob eine gesetzliche Krankenversicherung der erste Schritt zum Sozialismus ist und aus diesem Grunde verdammenswert sei? Nicht auf einer Zeitreise, sondern in den USA im Jahre 2011.

Dieser Gedanke sowie einige weitere Eindrücke haben mir wieder einmal gezeigt, dass die US-amerikanische Mentalität teils befremdlich auf mich wirkt. Ich weiß, ich kann den Begriff Mentalität nicht absolut setzen und somit auf alle US-Bürger beziehen, aber im öffentlichen Raum spiegeln sich Dinge wider, die mich irritieren. Zunächst einmal die öffentliche Erinnerung: in Washington gibt es ein Museum zur Geschichte der Indianer.
Als ich in den ersten Raum kam, dachte ich, ich sei in Mexiko, quasi bei mir um die Ecke. Wunderbare Exponate zur Geschichte der Azteken und Maya, doch was hat das mit den Ureinwohnern des Gebietes der heutigen USA zu tun? Auch in den Straßenbildern der Städte sieht man sie nicht. In New York erklärte mir jemand, dass es sie nach wie vor auch an der Ostküste gebe. Und nicht -wie manche denken würden- komplett ausgerottet worden seien. Allerdings leben sie auch hier in Reservaten (und ich hoffte, dass die sich nicht wie in Arizona und Nevada in der Nähe von Atomtestgebieten befinden). Dort ist das Glücksspiel erlaubt und damit verdienen sie heutzutage ihr Geld. Aber im öffentlichen Raum tauchen sie nicht auf – ihre Lobby scheint im Gegensatz zu der der Schwarzen zu schwach oder gar nicht vorhanden zu sein.

Geschichtsverdrängung gibt es aber nicht nur auf diesem Gebiet: während ein Holocaustmuseum in Washington die Gräuel der Nazis zeigt, gibt es in der Nähe das Memorial zum Vietnamkrieg. Granitplatten mit unzähligen Namen von tapferen US-Soldaten. Hinter jedem Name steckt eine Geschichte? Doch welche – die bleibt verborgen. Denn es gibt kein Museum, das diese Geschichten erzählt. Eine kritische Auseinandersetzung sucht man auch vergebens im 09/11-Memorialmuseum in New York. Bedrückend sind die Exponate, Tondokumente und Bilder – doch welche politischen Entscheidungen daraus folgten, die Darstellung bleibt aus. Vielleicht ist auch etwas viel verlangt, den Leuten die jüngste Vergangenheit sowie die Gegenwart gegenüber zu stellen.
Eigentlich habe ich mich gefragt, ob es überhaupt angebracht sei, diesmal von „…bei den Mexis“ zu sprechen, da ich doch nun drei Wochen in den USA unterwegs gewesen bin (abgesehen davon, glaube ich, dass fast jeder bereits einmal in den Staaten war und von dort mit seinen eigenen Eindrücken zurückgekehrt ist). Aber vielleicht passt es doch, da ich in New Yorker Cafés fast nur mexikanische Angestellte gesehen habe und stellenweise besser mit Spanisch als mit Englisch durchkam. Doch nicht nur Mexikaner sind auf dem Gebiet der Dienstleistung sichtbar.

Neben Schwarzen sind es auch andere Menschen aus Lateinamerika. Aber in einem kleineren Ort haben wir auch Ausnahmen getroffen. Wir haben einige Tage in Winthrop in der Nähe von Boston übernachtet und morgens immer dasselbe Café aufgesucht. Dort wurden wir am dritten Tag von einer Frau mit „Guten Morgen“ begrüßt. Sie kam aus Albanien, ihr Bruder lebe in Deutschland, aber er bekomme dort keinen Pass. So wisse er nicht, wann er wieder nach Albanien zurück müsse. So war auch einmal kurz in Deutschland. Aber wie gesagt, die Deutschen geben keine Pässe. Hier in den USA sei es viel einfacher. Aber sonst? Die USA seien gut für „money“. Mehr nicht. Sie zuckte die Schultern…
Nach wie vor scheinen die Vereinigten Staaten der potenzielle Sehnsuchtsort zu sein: vom Tellerwäscher zum Millionär – die Illusion scheint immer noch zu wirken. Was ich vor allen Dingen in New York sah, war ein gigantischer Niedriglohnsektor mit Migranten. Die sich wahrscheinlich nicht das Frühstück leisten können in dem Laden, in dem sie arbeiten.
So krass habe ich das in den anderen Orten nicht wahrgenommen wie in New York – aber der Eindruck blieb: einmal Tellerwäscher, immer Tellerwäscher. Und einmal Oberschicht, immer Oberschicht: diesen Eindruck bekam ich beim Schlendern über den Harvard Campus. Hier rekrutiert sich das Geld von einer Generation zur nächsten. Hier werden die Posten der Väter an die Söhne weitergereicht und im J.F.K.-Memorialmuseum kann man sehen, wie Familiendynastien funktionieren.

Etwa 40 Kilometer westlich von Boston liegt Concord – das, wie ich aber erst hinterher erfuhr als US-amerikanisches Weimar gilt. Eben als Ort der US-amerikanischen Literaturklassik. Hier haben sich nicht nur Ralph Waldo Emerson oder Henry David Thoreau niedergelassen, sondern hier fanden auch am 19. April 1775 die ersten Kämpfe des Unabhängigkeitskrieges zwischen den Kolonialisten und den Engländern statt. Auf einem Trail kann man die Schlacht dieses Tages abwandern, die mit einer mir kaum vorstellbaren Brutalität abgelaufen sein muss. Heute spaziert man durch eine Landschaft, die mich stark an Eifelwälder erinnerte.

Kurzum: sehr schön – auch sieht man die ersten von den Kolonialisten bewirtschafteten Felder. Noch war es im 17. Jahrhundert nicht zur Ausrottung der Indianer gekommen – im Gegenteil: die Kolonialisten waren auf ihre Hilfe angewiesen und man lebte fast ein Jahrhundert miteinander. Dass wir dort überhaupt wandern konnten, haben wir einer älteren Dame zu verdanken: Patty. Denn wir waren davon ausgegangen, dass es sich um einen Rundwanderweg handeln würde. Bei der Touristeninformation wurden wir eines besseren belehrt – und auch, dass es keine Busverbindung zwischen Concord und Lexington (dem Zielort) gibt. Und einfach mal so 30 Kilometer wandern, dazu waren wir zu spät. Patty stand dort und hörte von unserem Dilemma. Sofort bot sie uns an, mit ihrem Wagen zum Zielpunkt zu fahren. Dann könnten wir einfach zurückwandern. Doch damit nicht genug: sie zeigte uns noch eine andere historische Stelle (die Northern Bridge, dort sind die ersten englischen Soldaten gestorben) und versorgte uns noch mit Wasserflaschen.

Der Eindruck blieb: sie sind höflich, hilfsbereit und freundlich – die US-Amerikaner. Vielleicht auch noch ein Mentalitätsunterschied.
Warum nun doch „… bei den Mexis“ im Titel schreibe, liegt daran, dass wir nach unserer Rückkehr sofort im mexikanischem Alltag ankamen: wir standen im Dunkeln, denn der Elektriker unserer neuen Nachbarin hatte einfach mal unser Hauptleitungskabel im Flur durchgeschnitten. Die nächste Unverfrorenheit kam dann von der Señora selbst: dieses Kabel hätte überhaupt nicht zu unserer Wohnung gehört und so hätte sie auch das Recht gehabt es zu kappen. Erst als ein anderer Elektriker, den wir dazu gerufen hatten, ihr erklärte, dass das ein Trugschluss sei, wurde sie wieder schmierfreundlich. Der nächste Schrecken kam dann auch noch: sie zieht nicht allein ein, sondern bringt auch noch kleine Kläffer mit. Für die baut sie –ohne Baugenehmigung- einen Balkon. Dafür hat sie zur Straßenseite erst einmal die Außenfassade eingerissen.
Apropos Kläffer: unser anderer Nachbar teilte uns vorgestern mit, dass Rodrigo Anfang September ausziehen werde. Ich sage nur: abwarten. Das nächtliche Singen hat er übrigens aufgegeben, dafür hat er eine andere Beschäftigung während dieser Tageszeit gefunden. Ich dachte zunächst, er würde nun regelmäßig um ein Uhr nachts Möbel in seinem Zimmer verrücken. Dann klärte uns sein Vermieter auf, dass er sich eine manuelle Waschmaschine angeschafft hat, die er um die Uhrzeit bedient.
An meinem zweiten Arbeitstag war ich morgens mit einem Taxi auf dem Weg zur Schule. Aufgrund von Bauarbeiten sind wir nicht die mir gewohnte Strecke gefahren, sondern eine Parallelstrecke. Immer wenn ich sagte, hallo, sollen wir nicht rechts fahren, bekam ich die Antwort vom Fahrer: nee, ich kenne da eine Superstrecke. Bis sich herausstellte, dass er das Colegio mit einer Privatuni ganz im Westen der Stadt verwechselt hatte.
Dann wurde er doch unruhig. Doch irgendwie wurschtelten wir uns zurück, denn ich kannte mich ein wenig dort aus. Wir befanden uns nämlich in der Nähe des Krankenhauses, in dem ich im Frühjahr operiert worden bin. Auf der Gegenseite staute sich der Verkehr kilometerlang und die Autoschlange riss auch bis zur Schule nicht ab, die ich mit einer halbstündigen Verspätung erreichte.
Die Verwaltungssekretärin wurde etwas blass, als ich mitteilte, wo ich denn gerade überall herumgefahren sei. Ob ich sie denn gesehen hätte? Ich: wen denn? Na, sie hätten doch an der neuen Brücke unterhalb des Krankenhauses heute Morgen zwei Männer dort aufgehängt gefunden. Zum Glück habe ich das nicht gesehen, ich war in dem Moment viel zu sehr mit der Suche der richtigen Richtung beschäftigt. Mir wurde doch etwas mulmig: ist das doch eine neue Qualität der Auseinandersetzung der Drogenkartelle hier. Bislang wurde der öffentliche Raum verschont – das gab es bislang nur im Norden (und in der Zeitschrift „Processo“ – die man unter der Fragestellung „Was halte ich eigentlich an Bildern aus?“ durchblättern kann, wenn dort wieder die Gehängten und Geköpften gezeigt werden). Und es zeigt auch, dass sich das in einem der reichsten Stadtviertel abspielt. Ich wurde hinterher auch darüber aufgeklärt, dass die meisten Drogenbosse dort auch leben würden.
Da bleibe ich dort lieber mittelschichtig in Polanco – und bilde mir weiterhin ein, dass hier so etwas nicht passieren kann.
Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich höre mal wieder etwas von euch. Bis dahin!
Muchos saludos,
Marion